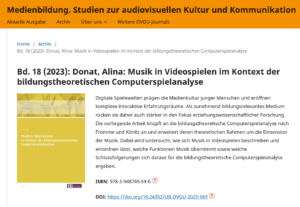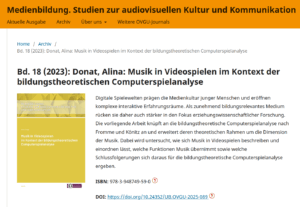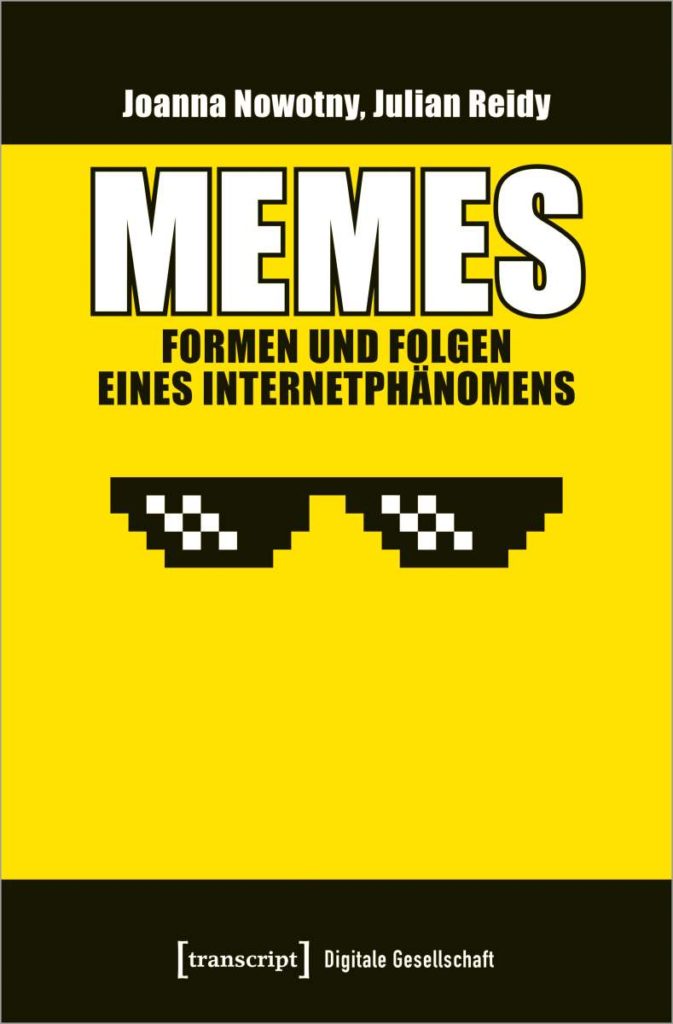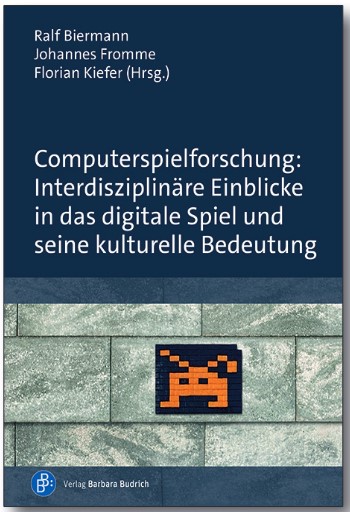Die KI-Anwendung ChatGPT wird ja gegenwärtig sowohl in der Wissenschaft wie auch in der interessierten Öffentlichkeit stark diskutiert – und sehr unterschiedlich eingeschätzt. Und natürlich ist KI auch in der Medienpädagogik ein Gegenstand der Auseinandersetzung in Theorie und Praxis.
Hier der Link auf einen Fachartikel in der medienpädagogischen Fachzeitschrift „Medienimpulse“, der im Band 61 (Nr. 1, 2023) „Medienpädagogische Entwürfe der Zukunft: Nachhaltigkeit, Zukunftsvisionen und Science-Fiction“ soeben erschienen ist.
Unter dem Titel „Vom Chat zum Check. Informationskompetenz mit ChatGPT steigern“ geben die österreicher Kollegen Erich Schönbächler, Thomas Strasser und Klaus Himpsl-Gutermann einen sehr guten und fundierten Über- und Einblick in den den Stand der KI-Systeme und diskutieren darauf aufbauend deren Bedeutung für Schule und Hochschule. Die praxisnahen Erläuterungen werden mit einem konkreten Unterrichtsentwurf abgeschlossen.
Hervorzuheben ist auch der wichtige Hinweis, dass sich der Beitrag der Medienpädagogik für die Schule nicht auf Fragen der Mediendidaktik reduzieren lässt. Neben einer anwendungsorientierten Perspektive („Wie nutze ich das?“) steht eine technologische Perspektive („Wie funktioniert das?“) sowie eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive („Wie wirkt das?), die in einer vertieften Auseinandersetzung und Reflexion verbunden werden müssen. Darüber hinaus wird formuliert, dass medienkompetente Lehrende eine zentrale Voraussetzung sind, um Nutzungsunterschieden im Sinne einer Digital Inequality bzw. im Sinne einer Chancenungleichheit zu begegnen.
Besten Dank für diese fundierte medienpädagogische Perspektive!
Abstrakt:
„Der Beitrag greift den aktuellen Diskurs um die KI-Anwendung ChatGPT und deren Bedeutung in Schule und Hochschule auf.Dabei werden durch einen Überblick über verschiedene Assistenzsysteme, die auf Künstlicher Intelligenz beruhen, Grundlagen und Unterschiede herausgearbeitet. Der Bereich der Chat-bots wird näher beleuchtet, die beiden grundlegenden Arten des regelbasierten Chatbots und des Machine Learning Bots werden anhand von anschaulichen Beispielen praxisnah erklärt. Schließlich wird herausgearbeitet, dass Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts auch die wesentliche Grundlage dafür ist, im Bildungsbereich konstruktiv mit KI-Systemen wie ChatGPT umzugehen und die wesentlichen Funktionsmechanismen zu verstehen. Ein Unterrichtsentwurf zum Thema „Biene“ schließt den Praxisbeitrag ab.“
„Was bedeutet dies für die Aus-, Fort- und Weiterbildung?“
„Medien- und Informationskompetenz muss fester Bestandteil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sein. Lehrerinnen und Lehrer, die selbst nicht wissen, wie eine Recherche oder die Handhabung eines KI-Textgenerators funktionieren, sind nicht in der Lage, dies den Schülerinnen und Schülern adäquat zu vermitteln. Den Lehrerinnen und Lehrern muss die anwendungsorientierte Perspektive (Wie nutze ich das?), die technologische Perspektive (Wie funktioniert das?) und die gesellschaftlich-kulturelle (Wie wirkt das?) aufgezeigt werden, sodass sie dieses Wissen entsprechend ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln und reflektieren können (Brinda et al. 2019: 27). Es braucht medienkompetente Lehrerinnen und Lehrer auch aus einer inklusiven Perspektive, weil die Digitalisierung die Leistungsheterogenität zwischen den Schülerinnen und Schülern erhöht (vgl. Denton-Calabrese et al. 2021; Merisalo/Makkonen 2022). Das heißt, bessere Schülerinnen und Schüler ziehen aus den digitalen Werkzeugen und Medien mehr positiven Nutzen als schlechtere Lernende. Diesem Umstand kann nur durch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und einer entsprechenden Infrastruktur für alle entgegengewirkt werden.“
Schönbächler, E., Himpsl-Gutermann, K., & Strasser, T. (2023). Vom Chat zum Check. Informationskompetenz mit ChatGPT steigern. Medienimpulse, 61(1), 51 Seiten. https://doi.org/10.21243/mi-01-23-18